Bilder von Armin Schwarz

Armin Schwarz

Armin Schwarz
77 1400x936 Px, 05.01.2026
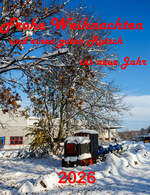
Armin Schwarz
46 1230x1600 Px, 23.12.2025

Armin Schwarz
70 1400x939 Px, 21.12.2025

Armin Schwarz
91 1500x1000 Px, 21.12.2025

Armin Schwarz
87 1400x1019 Px, 21.12.2025

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Armin Schwarz
73 1400x957 Px, 19.12.2025

Armin Schwarz
59 1400x941 Px, 17.12.2025

Armin Schwarz
39 1400x973 Px, 08.12.2025

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Armin Schwarz
132 1400x949 Px, 21.11.2025

Armin Schwarz

Armin Schwarz
99 1400x938 Px, 18.11.2025

Armin Schwarz
144 2 1400x957 Px, 15.11.2025

Armin Schwarz
120 1400x933 Px, 14.11.2025

Armin Schwarz

Armin Schwarz
81 1400x933 Px, 09.11.2025

Armin Schwarz
109 1400x1383 Px, 09.11.2025
![Die DB 101 018-0 (91 80 6101 018-0 D-DB) der DB Fernverkehr AG, kommt am 21 Oktober 2025, mit dem EC 7 (Hamburg-Altona - Köln - Mainz - Basel SBB) [ehem. weiter über Bern nach Interlaken Ost], über Hohenzollernbrücke und erreicht so nun den Hauptbahnhof Köln. Hinter der DB 101 sind SBB EuroCity-Wagen. Die EuroCity-Wagen (Apm EC und Bpm EC) der SBB sind zwar nach ähnlichen Prinzipien aufgebaut worden, werden aber in der Schweiz nicht als Einheitswagen bezeichnet. Eine Ausnahme ist der eingereihte Speisewagen (WRm 61 85 88-94 113-7 CH-SBB), diese sind Einheitswagen IV.
Die Lok wurde 1996 von ADtranz (ABB Daimler-Benz Transportation GmbH) in Kassel unter der Fabriknummer 33128 gebaut.
Aufgrund der großen Verspätungen des EC 7 von Hamburg-Altona nach Interlaken Ost und des EC 9 von Dortmund Hbf nach Zürich HB verkehren beide Linien ab dem 29. April 2025 fahrplanmäßig nur noch bis Basel SBB. Wobei dieser Zug in Köln pünktlich war.
Für den Schweizer Linienabschnitt ab Basel SBB nach Zürich HB und Interlaken Ost kommen Ersatzzüge zum Einsatz. Reisende von Deutschland aus dem EC 7 und dem EC 9 in Richtung Schweiz steigen in Basel SBB um. Diese Maßnahme wurde bei großen Verspätungen bereits in Vergangenheit umgesetzt.
Nicht betroffen sind der EC 6 von Interlaken Ost nach Dortmund Hbf und der EC 8 von Zürich HB nach Hamburg-Altona. Diese Züge verkehren weiterhin grenzüberschreitend. Die DB 101 018-0 (91 80 6101 018-0 D-DB) der DB Fernverkehr AG, kommt am 21 Oktober 2025, mit dem EC 7 (Hamburg-Altona - Köln - Mainz - Basel SBB) [ehem. weiter über Bern nach Interlaken Ost], über Hohenzollernbrücke und erreicht so nun den Hauptbahnhof Köln. Hinter der DB 101 sind SBB EuroCity-Wagen. Die EuroCity-Wagen (Apm EC und Bpm EC) der SBB sind zwar nach ähnlichen Prinzipien aufgebaut worden, werden aber in der Schweiz nicht als Einheitswagen bezeichnet. Eine Ausnahme ist der eingereihte Speisewagen (WRm 61 85 88-94 113-7 CH-SBB), diese sind Einheitswagen IV.
Die Lok wurde 1996 von ADtranz (ABB Daimler-Benz Transportation GmbH) in Kassel unter der Fabriknummer 33128 gebaut.
Aufgrund der großen Verspätungen des EC 7 von Hamburg-Altona nach Interlaken Ost und des EC 9 von Dortmund Hbf nach Zürich HB verkehren beide Linien ab dem 29. April 2025 fahrplanmäßig nur noch bis Basel SBB. Wobei dieser Zug in Köln pünktlich war.
Für den Schweizer Linienabschnitt ab Basel SBB nach Zürich HB und Interlaken Ost kommen Ersatzzüge zum Einsatz. Reisende von Deutschland aus dem EC 7 und dem EC 9 in Richtung Schweiz steigen in Basel SBB um. Diese Maßnahme wurde bei großen Verspätungen bereits in Vergangenheit umgesetzt.
Nicht betroffen sind der EC 6 von Interlaken Ost nach Dortmund Hbf und der EC 8 von Zürich HB nach Hamburg-Altona. Diese Züge verkehren weiterhin grenzüberschreitend.](/bilder/thumbs/deutschland--e-loks--drehstrom--91-80--682011018195br-101-900375.jpg)
Armin Schwarz
![SBB EC-Großraum-Reisezugwagen (EC-Wagen) der ersten Wagenklasse 61 85 10-90 249-6 CH-SBB der Gattung Apm 1090, eingereiht als Wagen Nr. 264 in den EC 7 (Hamburg-Altona - Köln - Mainz - Basel SBB) [ehem. weiter über Bern nach Interlaken Ost], am 21 Oktober 2025 beim Hauptbahnhof Köln.
Der Wagen wurde 1993 von Schindler Waggon AG (SWP) gebaut, die Drehgestelle sind von SIG.
Die Drehgestelle gehören zur Familie der bei den EW IV und bei den neuen Pendelzügen (NPZ) bewährten Bauart. Sie entstammen dem Baukastensystem der Firma SIG - Schweizerische Industriegesellschaft in Neuhausen und sind in der Primär- und Sekundärstufe mit FlexicoiI-Schraubenfedern ausgerüstet, besitzen Magnetschienenbremsen und Schlingerdämpfer. Die Lasttraverse dient als einzige mechanische Verbindung zum Wagenkasten. Hohe Laufruhe und volle Sicherheit sind bis 200 km/h gewährleistet. SBB EC-Großraum-Reisezugwagen (EC-Wagen) der ersten Wagenklasse 61 85 10-90 249-6 CH-SBB der Gattung Apm 1090, eingereiht als Wagen Nr. 264 in den EC 7 (Hamburg-Altona - Köln - Mainz - Basel SBB) [ehem. weiter über Bern nach Interlaken Ost], am 21 Oktober 2025 beim Hauptbahnhof Köln.
Der Wagen wurde 1993 von Schindler Waggon AG (SWP) gebaut, die Drehgestelle sind von SIG.
Die Drehgestelle gehören zur Familie der bei den EW IV und bei den neuen Pendelzügen (NPZ) bewährten Bauart. Sie entstammen dem Baukastensystem der Firma SIG - Schweizerische Industriegesellschaft in Neuhausen und sind in der Primär- und Sekundärstufe mit FlexicoiI-Schraubenfedern ausgerüstet, besitzen Magnetschienenbremsen und Schlingerdämpfer. Die Lasttraverse dient als einzige mechanische Verbindung zum Wagenkasten. Hohe Laufruhe und volle Sicherheit sind bis 200 km/h gewährleistet.](/bilder/thumbs/schweiz--personenwagen--ec-wagen8195pm-900374.jpg)
Armin Schwarz
109 1400x1021 Px, 08.11.2025